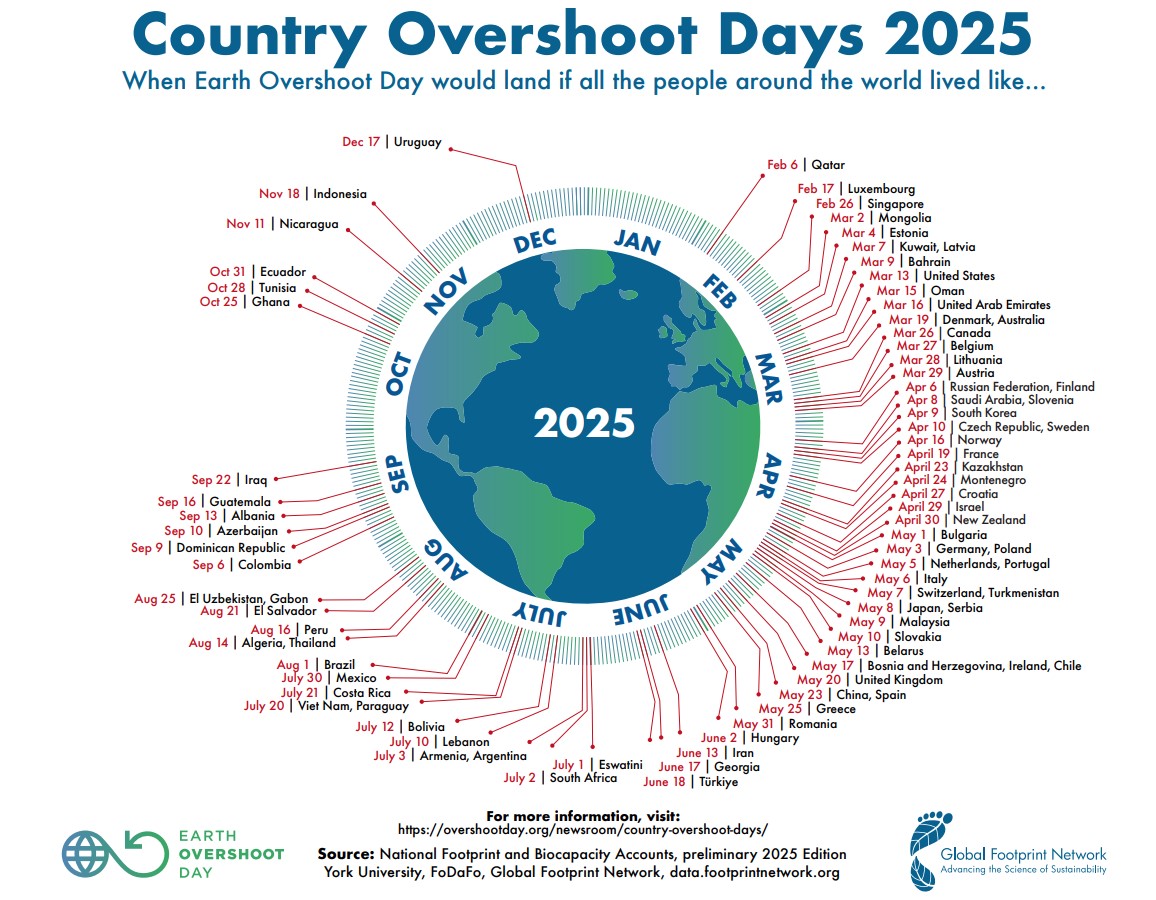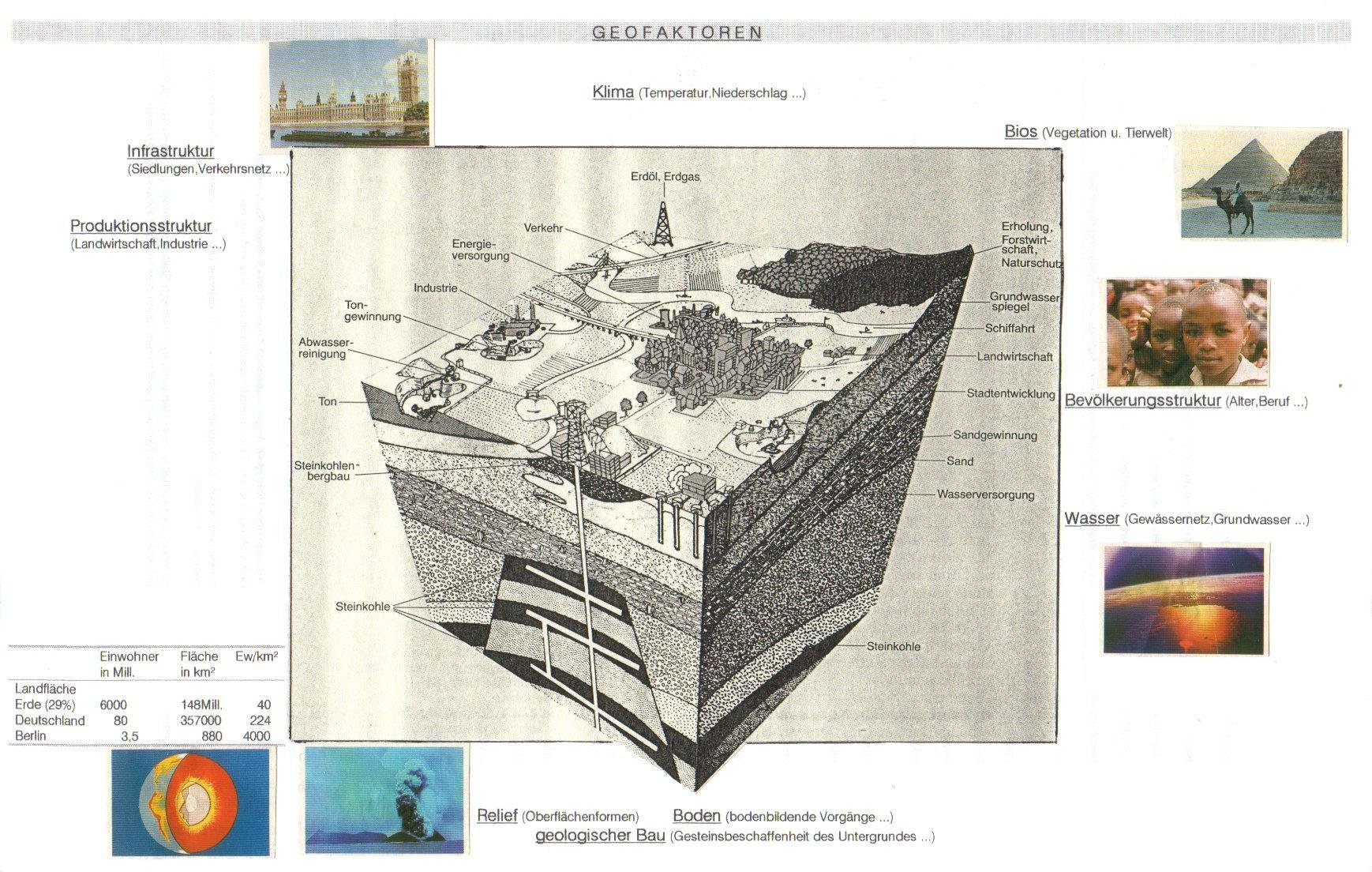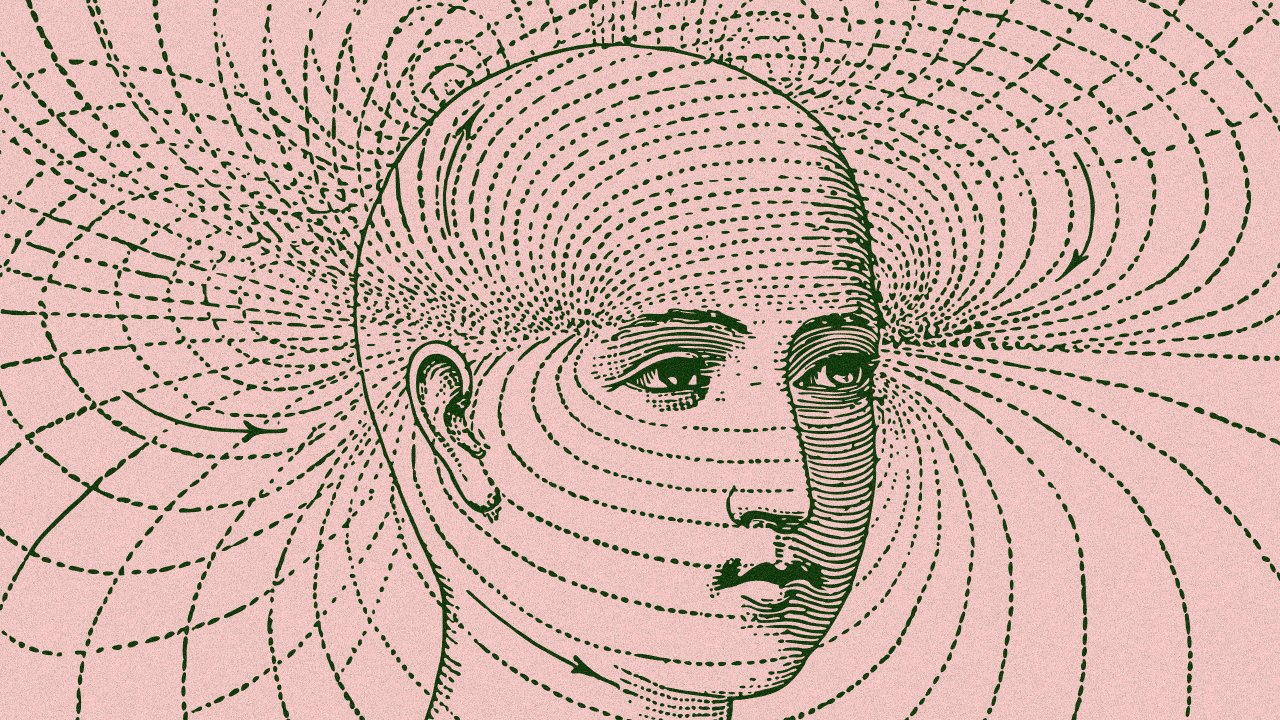Geographie
& Geschichte [2] [3]
Archiv
historische
Karten ![]() Zeittafel [2] [3]
[4]
Zeittafel [2] [3]
[4]
Die Einteilung in
Gut und Böse in einem Boot bei schwerer See führt zum Untergang.
[Streit-/ Konfliktlösungen] UKR
[1]
[1a] [2
-
2] [2a]
[3
- 3] ![]() [2]
Feb.
2024 Feb.
2025
[2]
Feb.
2024 Feb.
2025
Karten
Vergleich
NATO & Russland NATO-Generalsekretär
Rutte: „Wir müssen
uns auf Krieg vorbereiten." Klartext
von R. D. Precht
UN-Generalsekretär:
„Die Welt steht am Abgrund." Hiroshima Frieden
 Vertrauen
Vertrauen
Albert
Einstein: „Ich bin
nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird,
aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.“
Telepolis Intuition Kontext Politiker, Parteien, Wahlen Analyse [2] [3]
![]() Fakten [2] [3] BR investigativ
2
[3]
Karten
Fakten [2] [3] BR investigativ
2
[3]
Karten
![]() Dynamic
World historisch
[2] [3] [4] [5] Stadtpläne
Bln. DDR
Dynamic
World historisch
[2] [3] [4] [5] Stadtpläne
Bln. DDR
Statistik NATO-Russland-Vergleich Migration Welt-Bev. OECD mehr Stat. Bundesamt [2] [3] [4] [5] Kartografik
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful world.
The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do
They're really saying I love you.
I hear babies crying, I watch them grow
They'll learn much more than I'll never know
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world.
f.f.f.-Jugend [2] vereint euch mit s.f.p.f.-altersübergreifend [2] global und heute für
eine ökologisch wirksame Reduzierung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid [durch Stoppen von ungefilterter industrieller Holz-/ Kohle-/ Erdöl-/ Erdgasverbrennung, Ausbau einer regenerativ-dezentralen Energieerzeugung
und umweltverträglichen Mobilität, ökologischen Stadtumbau ...] sowie das 25-mal treibhauswirksamere Methan [durch Einstellung der Massentierhaltung und gesündere Essgewohnheiten mit weniger Fleisch & Wurst ...],
eine Reinhaltung der Meere [durch Stoppen der Einträge von ungeklärten Abwässern & (Plastik-)Müll] und ein Verhindern der industriemäßigen Überfischung mit dem Ziel, das pflanzliche wie tierische Leben im Meer zu bewahren bzw. wiederzubeleben,
den Schutz der Böden, des Grundwassers, der Gewässer und damit der Pflanzen- und Tierwelt [durch Umwandlung der chemisierten land- u. forstwirtschaftlichen Massenproduktion mit Profit-Hybriden zu einer ökologischen Land- u. Forstwirtschaft, in der Sorten- u. Artenvielfalt, eine regional-saisonale Versorgung mit geschmackvollen Produkten, Landschaftspflege ... im Vordergrund stehen] und
den Umbau der Konsum-Wegwerf-Gesellschaft des ständigen Wachstums hin zu einer
nachhaltigen Gesellschaft ohne Hochrüstung, die die global-ökologischen Herausforderungen vor Unternehmensinteressen sowie vor weltanschauliche, staatliche und persönliche Egoismen stellt.

![]() CO2-Emissions
Map Klimaveränderungen
Dein
ökologischer Fußabdruck?
CO2-Emissions
Map Klimaveränderungen
Dein
ökologischer Fußabdruck?
![]() Landschaften
im Wandel Endlagersuche für radioaktive Abfälle
Landschaften
im Wandel Endlagersuche für radioaktive Abfälle
Nahrungsmittelversorgung - Boden - (Grund)Wasser - Luft / Klima - Biodiversität - Nachhaltigkeit / ökologisches Gleichgewicht - gesellschaftliche Verantwortung

Vier
Konzerne dominieren künftig weltweit das Geschäft mit Saatgut,
Dünger und Pflanzenschutzmitteln in der Agrochemiebranche
– allen voran die deutsche Bayer-Monsanto AG
... aus verschiedenen Quellen 06/2020
Der Bayer-Konzern
hat Monsanto für rund 56 Milliarden Euro übernommen. Umweltschützer
machen gentechnisch verändertes Saatgut und aggressives Unkrautvernichtungsmittel
für zahlreiche Umweltschäden verantwortlich. Das Pflanzenschutzmittel
Glyphosat von Monsanto steht im Verdacht, krebserregend zu sein.
Diesen Vorwürfen hat Bayer stets widersprochen und darauf verwiesen,
dass Zulassungsbehörden weltweit das Herbizid bei sachgemäßer
Anwendung als sicher bewerteten. In den USA wurde Bayer bereits in mehreren
Fällen zu hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt.
Saatgut: Die Vielfalt der Pflanzen ist in Gefahr! In den Gärten
gedeihen nur noch CMS-Hybride und andere Mutationen. Zwar ist das Wachstum
intensiver und die Blüten sind schöner, aber hat hier schon
jemand eine Biene entdeckt?
Im Gemüse- und Getreideanbau: So genannte F1- und CMS-Hybride
liefern hohe Ernten bei gleichbleibender Qualität. Wenige Sorten
wachsen auf immer größeren Feldern, die nicht nur Nahrung
sondern auch nachwachsende Rohstoffe bieten sollen. In Deutschland und
Europa haben Hybridsorten (hybride, von lat. hybrida = Mischling) bei
vielen Obst- und Gemüsearten einen Marktanteil von über neunzig
Prozent. Zum Beispiel bei Mais, Zuckerrüben, Tomaten, Zwiebeln
und verschiedenen Kohlsorten. CMS-Hybride finden wir sogar
im Bioladen, ohne dass sie speziell gekennzeichnet sind. Das CMS
steht für „cytoplasmatische männliche Sterilität“,
eine genetisch veränderte Eigenschaft, die verhindert, dass Pollen
gebildet werden können. Die Nachkommen dieser Kreuzungen sind besonders
ertragreich, aber nur in der ersten Generation und als Saatgut unbrauchbar.
Das bedeutet: Saatgut muss jedes Jahr beim Züchter neu gekauft
werden.
Naturnah gärtnern wird zur echten Herausforderung, denn es gibt
kaum noch natürliches Saatgut: Samenfestes Saatgut, das
sich selbst vermehren kann. Die großen Player der Agrarindustrie
bestimmen den Markt für Saatgut, Pestizide, Düngemittel und
Futtermittel. Eine unvorstellbare Machtkonzentration, denen das Interesse,
seine Pflanzen durch herkömmliche Züchtung wiederstandsfähiger
zu machen, völlig fremd ist. Das dauert, kostet Zeit und Geld.
Nur die Gentechnik und hoher Pestizideinsatz bringen schnell hohe Gewinne.
In den vergangenen hundert Jahren haben wir bereits weltweit etwa 75
Prozent der landwirtschaftlich genutzten Vielfalt verloren. Ein freier
Austausch von Samen und Setzlingen zwischen Bauern, Saatgutinitiativen
und Gärtnern ist nicht erwünscht. Auch das Europäisches
Patentamt gerät völlig außer Kontrolle: Obwohl das Europäische
Parlament und der Deutsche Bundestag dagegen intervenierten und das
Europäische Patentabkommen Patente auf Pflanzensorten grundsätzlich
ausschließt, erteilt es weiterhin Patente auf Pflanzen. Auch solche,
die das Ergebnis herkömmlicher Züchtung sind. Bayer-Monsanto
gehören z.B. Melonen, geköpfter Brokkoli. Zuletzt wurde eine
Chili-Sorte von Syngenta patentiert.
Es gibt
jedoch große regionale Unterschiede. Während die Landwirtschaft
in den Industrieländern hauptsächlich mit kommerziellem Saatgut
versorgt wird, ist sie in Entwicklungsländern – noch! - von
bäuerlichem Nachbau und Austausch geprägt. In Indien liegt
der Anteil von kommerziellem Saatgut in der Landwirtschaft bisher nur
bei 30%, in Afrika aktuell unter 10%. Traditionelle Höfe funktionierten
als nahezu geschlossene Systeme. Von der Ernte wurde ein Teil zurückbehalten,
um erneut ausgesät zu werden, in einem ewigen Kreislauf. Heute
ist das in den meisten Teilen der Erde anders.
Im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft zu Beginn der 1950er
und verstärkt in den 1960er und 1970er Jahren wurden die Arbeitsabläufe
zunehmend mechanisiert und rationalisiert. Die sogenannte „Grüne
Revolution“ wurde in vielen Regionen der Welt durchgesetzt
mit dem Ziel, die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen. Das hat
dazu geführt, dass sich die Höfe beständig vergrößerten
und spezialisierten, der Landbau intensiviert wurde und sich die Massentierhaltung
durchsetzte. In der heutigen hochtechnologisierten Landwirtschaft bestehen
eigene Märkte für Tierzucht, Saatgut, Futtermittel, Düngemittel
und Pestizide. Die
Bauern sind zu Gliedern in langen Lieferketten geworden. Mit der
Entstehung landwirschaftlicher Großbetriebe verschwanden nach
und nach mittelständische Zuchtbetriebe, transnationale Unternehmen
wie Monsanto und Co konnten sich u.a. durch gezielte Firmenfusionen
und –aufkäufe herausbilden. Dieses Vorgehen drängt einerseits
Konkurrenten vom Markt, andererseits kann so Einfluss auf das Saatenangebot
und die Preise genommen werden. Die meisten der weltweit agierenden
Saatguthersteller gehören gleichzeitig auch zu den größten
Pestizidherstellern, allen voran Monsanto. Beides soll maximale Gewinne
einbringen.
Mit ihrem oft gentechnisch verändertem Hochleistungssaatgut versprechen
die Agrargroßkonzerne maximale Erträge und gegen Schädlinge
äußerst robuste Pflanzen bei einer auf Maschinen optimierten
Handhabbarkeit. Um die Erträge aus dem Saatgut weiter zu steigern
und ihre Gewinne zu maximieren sorgt zudem deren Hybridsaatgut.
Schon immer haben Bauern einen Teil ihrer Ernte zurückbehalten
und daraus ihr eigenes Saatgut selektiert, vermehrt und mit ihren Nachbarn
getauscht. In vielen Ländern spielt diese traditionelle Produktion
von Saat- und Pflanzgut auch heute noch eine große Rolle. Doch
kann jeder Landwirt das einmal erworbene Saatgut weiterzüchten,
gehen den Zuchtbetrieben viele potentielle Käufer durch die Lappen.
Ein wirtschaftlich genialer Schachzug der Saatgut-Großkonzerne
ist im Vergleich dazu das Hybridsaatgut. Das Hybridzüchtungen
sind so verändert, dass die erste Ernte bei optimaler Versorgung
mit Wasser, Dünger und Pestiziden einen 15-30% höherer Ertrag
abwirft, die nächste Generation des Saatguts aber wieder in eine
Vielzahl unterschiedlicher Pflanzenformen aufgeht. Ein Nachbau ist mit
modernen Hybriden meist nicht möglich, was einem „eingebauten“
Sortenschutz gleichkommt. Um die Erträge auf hohem Niveau zu
halten sind die Bauern gezwungen, jedes Jahr neues Saatgut zu kaufen.
Das Hybrid-Saatgut wird damit beworben, höhere Erträge einzubringen,
resistenter gegenüber Schädlingen und Krankheiten und technisch
leichter handhabbar zu sein. Kritiker setzen dem entgegen, dass dies
auch mit samenfesten Sorten erreichbar ist und verweisen auf Qualitätsprobleme,
zu hohe Preise, eine zunehmend eingeschränkte Sortenvielfalt und
die vermehrte Abhängigkeit von großen Saatgutkonzernen bei
Hybriden.
Die wettbewerbshemmende Wirkung kann zu einer massiven Zunahme der Saatgutpreise
führen. So sind beispielsweise die Preise für Baumwollsaatgut
seit der Einführung von gentechnisch veränderter Baumwolle
in den USA um das drei- bis vierfache angestiegen und auch in den Entwicklungsländern
ist es zu einer substanziellen Preiserhöhung gekommen. Die Mischung
aus Marktmacht, Hybridsaatgut und einer rigorosen Patentierung von Saatgut
hat gerade in den Ländern des Südens fatale Folgen. Die indische
Aktivistin Vandana Shiva engagiert sich schon viele Jahre gegen Monsantos
Monopolstellung in Indien. Der Großkonzern kontrolliert dort fast
die gesamte Baumwollproduktion, indem er andere Saatgutlieferanten aufgekauft
hat bzw. massiv unter Druck setzt. Damit haben die dortigen Bauern keine
Alternative zu Monsantos Gen-Pflanzen. Doch für viele Bauern ist
das Saatgut zu teuer und die Gewinne liegen unter den Erwartungen. Dazu
kommt, dass die Baumwollpflanzen oft von neuartigen Krankheiten befallen
werden. Im Gegensatz zu den traditionellen Sorten, die auf die Wetter-
und Bodenbedingungen der jeweiligen Region abgestimmt sind, sind diese
Sorten Schädlingen und den spezifischen Wetterbedingungen nicht
gewachsen. Weitere teure, gesundheits- und umweltschädliche Düngemitteln
und Pestizide müssen eingesetzt werden, um die Pflanzen zu schützen.
Das teure Monsanto-Saatgut hat bereits Hunderte indische Bauern in den
Ruin und sogar in den Selbstmord getrieben.
Seit einigen
Jahren drängen die Saatgutkonzerne verstärkt auf die Märkte
von Schwellen- und Entwicklungländern, in denen kommerzielles
Saatgut bisher einen geringen Teil ausmachte. Dabei machen sie sich
auch die Hoffnung zunutze, dass durch Züchtungen und Genmanipulation
Wunderlösungen für globale Probleme, wie z.B. den Klimawandel,
gefunden werden können. Doch die Zahlen vermitteln ein anderes
Bild: Nach Berechnungen der Welternährungsorganisation (FAO) sind
rund die Hälfte der 868 Millionen hungerleidenden Menschen weltweit
ressourcenarme Bauern, die nur mäßig fruchtbares Land bewirtschaften.
Dem gegenüber steht die Tatsache, dass die Saatgutkonzerne nur
1% ihrer für Forschung und Entwicklung budgetierten Mittel in Saatgut
investieren, das für Entwicklungsländer geeignet wäre.
Gleichzeitig begrenzen sie die allen offen stehende Vielfalt, indem
sie sich Patente auf Gene für Stresstoleranz und Trockenheitsresistenz
sichern und neue Allianzen mit Unternehmen in der synthetischen Biologie
gründen. Der Berichterstatter für das Recht auf Nahrung der
Vereinten Nationen, Olivier De Schutter warnt in seinem Bericht „Seed
policy and the right to food“: „Die Oligopole einiger Anbieter
können dazu führen, dass armen Landwirten der Zugang zu Saatgut,
einem für sie lebenswichtigen Produktionsmittel, verwehrt wird.
Und sie kann dazu führen, dass die Lebensmittelpreise steigen,
wodurch die Lebensmittel für die Ärmsten noch weniger verfügbar
werden.“ Um Armut und Hunger in den Ländern des Südens
zu bekämpfen ist es wichtig, dass Kleinbauern in den Ländern
des Südens der freie Zugang zu Saatgut erhalten bleibt. Über
informelle und lokale Strukturen kann es dann verkauft, getauscht und
entsprechend der klimatischen, ökologischen und kulturellen Bedürfnisse
weiterentwickelt werden.
Weltweit verstärkt die Konzentration auf dem Saatgutmarkt und die
damit verbundene Selektion des Saatguts auf wenige Hochleistungssorten
den Verlust der Vielfalt an Kulturpflanzen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts
sind laut Schätzungen der Welternährungsorganisation (FAO)
etwa 75 Prozent der Kulturpflanzenvielfalt verloren gegangen.
Gab es beispielsweise in Indien vor der »Grünen Revolution«
ca. 50.000 Reissorten, waren es 20 Jahre später auf dem größten
Teil des Kontinents schätzungsweise nur noch 40 Sorten. Die vielen
neuen Hybridsorten können in punkto genetischer Varietät nicht
mithalten, da sie sich viel zu ähnlich sind. Doch warum ist es
so wichtig, eine Vielfalt auch bei Kulturpflanzen zu bewahren? Das hat
vor allem damit zu tun, dass erst eine große genetische Bandbreite
an Eigenschaften es ermöglicht, dass sich unsere Landwirtschaft
spontan und durch gezielte Züchtungen an veränderte Umweltbedingungen
– Stichwort Klimawandel, neue Krankheiten oder Schädlinge
– anpassen kann. Verändern sich die Anbaubedingungen, können
Eigenschaften alter Sorten wieder interessant und wünschenswert
werden. Dazu ein Beispiel: In den 1970er Jahren wurden in Indien große
Teile der Reisernte durch einen Virus vernichtet. Doch unter 6273 untersuchten
Reissorten wurde eine Resistenz gefunden. Durch deren Einkreuzung konnte
die Verbreitung des Virus eingedämmt werden. Und auch die ästhethischen
Vorstellungen ändern sich: gewann vor wenigen Jahren noch der giftgrüne
Apfel das Rennen um die meisten Käufer, ist es heute wohl eher
der „natürliche“ Typ. Sogar moderne Züchtungsmethoden
(inkl. Gentechnik) müssen für neue Entwicklungen nach wie
vor auf in der Natur vorhandenes Genmaterial zurückgreifen. Dieser
Erkenntnisse und Erfahrungen zum Trotz begünstigt der aktuelle
rechtliche Rahmen der EU industrielles Saatgut – und mit ihm eine
Form der Landwirtschaft, mit der auch laut dem Weltagrarbericht die
Probleme der Zukunft nicht gelöst werden können.
EU-Richtlinien - Welches Saatgut Landwirte verwenden können,
d.h. wer die Rechte an Pflanzensorten besitzt, regeln das Sorten- und
Patentrecht. Da es in der EU einen gemeinsamen Markt gibt, wird dies
auf EU-Ebene geregelt. Wichtigstes Grundprinzipien der Richtlinien ist
es, dass nur Sorten gehandelt werden dürfen, die von einer nationalen
Behörde zugelassen sind. Mit der Zulassung soll gewährt sein,
dass nur hochwertiges Saatgut auf den Markt erhältlich ist. Welche
Kriterien Saatgut erfüllen muss, regelt das Saatgutverkehrsrecht.
Eine Sorte wird zugelassen, wenn sie unterscheidbar, homogen und stabil
ist. Damit zielen die Kriterien der Zulassung in erster Linie auf Hochleistungssorten
ab. Viele lokal angepasste, seltene und alte Sorten von Gemüse,
Obst und Getreide, die auf genetischer Vielfalt beruhen, können
diese Kriterien nicht erfüllen, da sie nicht einheitlich genug
sind. Zudem fehlen kleineren Betrieben und Gärtnereien oft die
nötigen Mittel, um kostspielige Testverfahren zu finanzieren. Züchter
können für ihre neuen Sorten zusätzlich noch einen privatrechtlichen
Schutz in Form eines „Sortenschutzes“ oder von Patenten beantragen.
Diese ähneln dem Urheberrecht auf Bücher und Musik: Erteilt
das Sorten bzw. das Patentamt diesen Schutz, können Züchter
über die Verwendung der von ihnen gezüchteten Sorten bestimmen.
Allen voran Monsanto schöpft das Patentrecht aus, um Mitstreiter
vom Markt zu drängen und Landwirte zum Kauf von konzerneigenem
Saatgut zu nötigen. Mehr dazu in dem Artikel Biopiraterie - Die
Plünderung von Natur und Wissen. Einzige Ausnahme bildete bisher
altes, bäuerliches Saatgut. Es darf von Privatpersonen und Initiativen
weitergegeben und getauscht werden. Doch im Mai 2013 stand eine Neuregelung
des Saatgutverkehrsrechts an. Die Richtlinien der EU-Agrarpolitik sind
darauf ausgelegt, die Produktivität abzusichern und kommen den
Bedürfnissen professioneller Saatgut-Anwender und –züchter
entgegen. Das Nachsehen haben nicht nur künftige Generationen,
sondern auch heutige Verbraucher und Gärtner. Denn was in die Supermärkte
gelangt, ist für den kommerziellen Anbau gezüchtet: ertragreich,
gleichzeitig erntereif, einheitlich, transport- und lagerfähig.
Der Geschmack bleibt dabei oft auf der Strecke.
Dass einige wenige Saatgutunternehmen den Saatgutmarkt dominieren und
damit die Grundlage unserer Lebensmittelproduktion in den Händen
halten gibt Grund zu Besorgnis. Aktuell fördert weder der rechtliche
Rahmen noch der Markt eine Vielfalt bei den Nutzpflanzen. Doch so ganz
verloren sind die seltenen, lokalen und alten Sorten noch nicht. Verschiedene
Initiativen und Vereine kümmern sich um den Erhalt der Vielfalt.
Fazit
Modernes,
standardisiertes Saatgut wird wie Gold gehandelt, und das Milliardengeschäft
liegt in den Händen weniger internationaler Agrarkonzerne. Sie
produzieren in Billiglohnländern - unter miserablen Bedingungen,
oft illegal mit Kinderarbeit und Frauenausbeutung. Schönheit und
lange Haltbarkeit der genmanipulierten Obst- und Gemüsesorten gehen
auf Kosten des Geschmacks und der Nährstoffe. Alte Sorten sterben
aus, auf Kosten der Biodiversität. Doch weder Landwirte noch Verbraucher
scheinen eine Wahl zu haben.
Nicht jeder technische Fortschritt bedeutet auch einen Fortschritt für
die Gesellschaft. Wenn die Verbraucher eine große Vielfalt und
möglichst wenig Gifte auf ihren Äckern wollen, müssen
sie dies auch bei der Politik einfordern und selbst auch aktiv werden.
![]() Lebensmittel
vom Erzeuger [2]
Gemüse
& Obst
Fleisch
& Wurst [2]
Lebensmittel
vom Erzeuger [2]
Gemüse
& Obst
Fleisch
& Wurst [2]
![]()

Sie sind vor ein paar Minuten geschlüpft! Sie sehen das Licht,
die Sonne, den Sand, das Meer zum ersten Mal, aber woher wissen sie,
dass sie zum Meer laufen müssen, um zu leben? Wer hat dir das beigebracht?
Es sind
in erster Linie die großen Konzerne, die Umweltprobleme und Klimawandel
verursachen durch eine schädliche Produktion, unsinnige Transportwege
und übermäßigen Ressourcenverbrauch. Wie kann es sein,
dass Produkte auf den Markt kommen, die nach Ablauf der Garantiefrist
aufgrund eingebauter "Fehler" kaputt gehen, nur weil das den
Umsatz steigert. Die Bundesregierung verhindert strengere Klimaschutz-Normen
und lässt sich das mit Großspenden der Konzerne bezahlen.
Wir brauchen eine ökologische Politik, die gleichzeitig sozial
ist, anstatt die Profite der Klimasünder zu schützen während
Natur und Menschen dafür zahlen.
Die Arbeit im Anthropozän Essay von Mathias Greffrath Soziologe, Schriftsteller und Journalist 01/2016
Eine knappe Weltgeschichte der Arbeit in praktischer Absicht
Homo sapiens ist der Primat, der Werkzeuge herstellen kann, vom Faustkeil und Pflug über Windmühle und Dampfmaschine bis zu den Computersystemen, die die geistige Arbeit automatisiert und die Fantasieproduktion standardisiert haben. Und wie es scheint, ist der neuerliche Automatisierungsschub erst am Anfang.
Einstweilen produziert der kapitalgetriebene Automatismus noch Überfluss, aber auch immer mehr Menschen ohne Arbeit und Einkommen. Im Norden werden sie durchgefüttert, aus ausgebluteten Südregionen hat die große Elendswanderung begonnen. Eine immer kleinere Minderheit besitzt und gestaltet die politischen, administrativen und technischen Apparate.
Homo sapiens scheint am Ende seiner Laufbahn, gefangen in den stählernen Netzen eines techno-ökonomischen Prozesses. Steuert der auf den ökologischen Kollaps hin? Bei den Elenden, den Ausgegrenzten, den Nutznießern, aber auch bei den Theoretikern wachsen Ratlosigkeit und Fatalismus. Und die Gewaltbereitschaft wächst, die der Elenden und die derjenigen, die ihren Wohlstand bedroht fühlen. Etwas in uns wehrt sich gegen die Alternativlosigkeit – aber worauf, auf welche Arbeit kann dieses Gefühl noch setzen.
„Hören Sie auf, vom Holozän zu sprechen...“ So begann Paul Crutzens zorniger Zwischenruf auf einer Geologenkonferenz vor 15 Jahren. Paul Crutzen, das ist der Atmosphärenchemiker, der das Ozonloch entdeckte und dafür den Nobelpreis erhielt. Und Holozän, so heißt die Epoche der Erdgeschichte, die vor 10.000 Jahren begann, am Ende der letzten großen Eiszeit.
„Hören Sie auf, vom Holozän zu sprechen, wir leben doch schon längst im Anthropozän.“ Anthropozän – das heißt: Zeitalter des Menschen, und Paul Crutzens Zwischenruf ist alles andere als beruhigend. Er resümiert, was wir spätestens seit einem halben Jahrhundert wissen: Die irdische Natur als Ganze ist zum Produkt der Menschen geworden. Und das markiert einen Bruch mit der Menschheitsgeschichte, über die wir Aufzeichnungen und Überlieferungen besitzen. Die begann im frühen Holozän. Zum Beispiel mit der Geschichte von Noah und seiner Arche. Denn die hat, wie alle Legenden einen realen Hintergrund – die Überschwemmung des Schwarzen Meeres vor 12.000 Jahren, während der letzten dramatischen Erderwärmung. Innerhalb von nur 40 Jahren stieg damals die Durchschnittstemperatur auf der Nordhalbkugel um sechs Grad Celsius. Das arktische Eis begann zu schmelzen, der Meeresspiegel stieg um Dutzende von Metern, trennte die Britischen Inseln vom Festland. In der Levante, dem fruchtbaren Halbmond, der sich von Griechenland bis in die Mündungsgebiete von Euphrat und Tigris zog, in China und Mittelamerika, erlaubte das Klima den Horden der Jäger und Sammler, sesshaft zu werden, Pflanzen anzubauen, Tiere zu zähmen, Vorräte zu bilden. In dieser „neolithischen Revolution“ entstanden die ersten Maschinen, der Pflug, der Webstuhl, die Töpferscheibe. Mit der Sesshaftigkeit das Eigentum an Grund und Boden, mit der Vorratshaltung die befestigten Städte. Die Arbeitsteilung differenzierte sich aus, und damit begann die dauerhafte, in Institutionen gefestigte Herrschaft von Menschen über Menschen, ob Sklaverei, feudale Hörigkeit oder Schuldknechtschaft. Aber jahrtausendelang noch beruhte die Produktivität der Arbeit im wesentlichen auf Naturkräften: auf der Muskelkraft der Menschen und Tiere, auf der Energie von Sonne, Wind und Wasser. Das Anthropozän beginnt, so definiert es Paul Crutzen, mit der Industriellen Revolution in Europa. Und paradoxerweise war es nicht der Erfindungsreichtum von Ingenieuren und Handwerkern allein, der die Produktivität explodieren ließ, sondern wiederum eine Naturkraft: die fossile Energie der Kohle, die Dampfmaschinen und Lokomotiven antrieb und den Wirkungsgrad der mechanischen Maschinen ins bis dahin Undenkbare erhöhte.
Ohne diese
industrielle Revolution wären die Forderungen der Unterschichtsrebellionen,
der Humanisten, der Aufklärung für immer im Himmel der Ideen
geblieben: die Erklärung der „gleichen, unveräußerlichen
Rechte: Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ ebenso
wie die Apotheose der Arbeit in der bürgerlichen Ideologie. Zwischen
den Fortschrittsreden der Ideologen und der schmutzigen Praxis in den
Fabriken der ersten Industrieperiode klaffte noch lange ein Abgrund.
Der Reichtum der Nationen beruht auf der Arbeitsteilung, so konnte man
es bei Adam Smith lesen. Aber im Kleingedruckten der gesellschaftlichen
Wirklichkeit stand als Fußnote: Das Eigentum ist geschützt.
Ein einklagbares Recht auf Arbeit – die Parole der frühen
Arbeiterbewegung – kennen die westlichen kapitalistischen Nationen
bis heute nicht. Dennoch: Auch wenn Millionen von Männern, Frauen
und Kindern in den Bergwerken und Fabriken des frühen 19. Jahrhunderts
vertiert und verschlissen wurden, auch die entstehende Arbeiterbewegung
setzte auf den Kapitalismus. Eine Gesellschaft der Freien und Gleichen,
eine wirkliche Demokratie werde es nur „in einer schon vorhandnen
Welt des Reichtums und der Bildung“ geben können, so schrieb
es der junge Karl Marx, und weiter: „Die Entwicklung der Produktivkräfte
[ist] auch deswegen eine absolut notwendige praktische Voraussetzung,
weil ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft
auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte
Scheiße sich herstellen müßte“. In der Vorhölle
der großen Industrie werde der Wohlstand erzeugt, auf dessen Grundlage
die Unterdrückung und die Ungleichheit schwinden, die Bürgerrechte
wirklich werden könnten. „An der Arbeit, die in unsichtbarer
Verkettung alle leisten, sind alle berechtigt.“ So postulierte
es nicht Dr. Marx aus London, sondern der AEG-Gründer und Gegner
des Erbrechts, Walter Rathenau aus Berlin. Und weiter: „Wirtschaft
ist nicht Privatsache“. Denn warum ist eine Nation reich geworden?
Da kommt viel zusammen: Weil ein Fürst mit den Steuern, die er
den Bauern abgepresst hat, eine Akademie der Wissenschaften und Manufakturen
gegründet hat; weil Bürger die Gewerbefreiheit erkämpften;
weil Migranten härter arbeiten als andere; weil es eine Religion
gab, die Fleiß als gottgefällig ansah; kurz: Die ganze Geschichte
einer Gesellschaft produziert mit. Und so verbreitet auch die modische
Staatsverdrossenheit der heutigen Gründer und Investoren sein mag:
Die grundlegenden Voraussetzungen, die Basisinvestitionen für den
technischen Fortschritt – Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen,
Verkehrssysteme, Rechtssicherheit – sie wurden immer von Staaten
geschaffen, von den Bewässerungsanlagen Assyriens bis hin zu Steve
Jobs oder Mark Zuckerbergs Imperien.
Seit den 70er-Jahren sanken die Wachstumsraten in den früh industrialisierten Ländern kontinuierlich
Wirtschaft ist also keine Privatsache, aber Wirtschaftsdemokratie bleibt eine schöne Formel, die es heute gerade noch in die programmatischen Schriften linker Parteien schafft. Das Arbeitsrecht, existenzsichernde Löhne, soziale Sicherheiten wären nicht denkbar gewesen ohne die Organisationskraft der Arbeiterbewegung. Der Sozialstaat, den die Sozialdemokratie nach den Katastrophen der Weltwirtschaftskrise und des Weltkriegs gegen den Verzicht auf Wirtschaftsdemokratie eintauschte, beendete – und ich spreche hier nur von West-Europa –, zwar den alten Klassenkampf. Aber das rasante Wachstum der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg – das Wirtschaftswunder – bescherte allen immer mehr, wenn auch den einen viel mehr, den anderen weniger. Diese Ausweitung der Konsumzone ließ die Kritik am Kapitalismus ebenso verstummen wie die Forderungen nach gesellschaftlicher Lenkung des technischen Fortschritts. Die Kapitalistische Welt schien erfolgreich und alternativlos: ein Reich des Wohlstands und der Freiheiten, wenn auch nicht der Gleichheit. Die Sache hatte nur drei Haken, und die bekommen wir seit ein paar Jahrzehnten zu spüren. Seit den 70er-Jahren sanken die Wachstumsraten in den früh industrialisierten Ländern kontinuierlich, und die Arbeitslosigkeit wurde chronisch. Steuersenkungen, Deregulierungen und Privatisierungen stabilisierten die Profite; Renten und Sozialleistungen wurden reduziert; von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wuchs die private und staatliche Verschuldung, die den Weltwirtschaftskrisen der letzten Jahre zu Grunde lag. Der zweite Haken ist die Globalisierung: Die Wohlstandsmaschine Kapitalismus hat sich von ihrem Territorium, dem Nationalstaat, emanzipiert. Über die politische Weltkarte von Nationen haben sich die Netze einer Art Turbofeudalismus gelegt. Es ist ein Feudalismus, dessen Herren nicht greifbar sind. Ihre Herzogtümer haben keine Grenzen, ihr Reichtum wird an 1.000 Orten hergestellt, auf der Erde verstreut wie die Besitztitel an ihrem Profit. Und ihre Landnahmen werden von den Finanzplätzen und Börsen gesteuert: Billionen frei flottierenden Geldes – der Profit vergangener Arbeit – drängen auf immer höhere Verzinsung und drücken so auf die Arbeitsgesellschaften der Welt. In den neuen Industrierevieren der ehemaligen Kolonien herrschen Arbeitsbedingungen wie im Frühkapitalismus; in den alten Metropolen wird die Arbeit bis zur Unerträglichkeit verdichtet. Die Barrieren der Ungleichheit liegen zunehmend nicht mehr zwischen armen und reichen Ländern, sondern zwischen den Zonen, in denen Kapital investiert wird, und dem sozialen Brachland, das sie umgibt. Und noch weiter draußen liegt das wüste Land, die neuen weißen Flecken, die die Weltkarte sprenkeln: die geplünderten Südregionen, die ökonomisch uninteressanten Gebiete, die Slums der Mega-Metropolen, in denen das Heer der Elenden wächst. Der dritte Haken, das ist die Wachstumsfalle. Die Produktivitätsexplosion von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wäre nicht möglich gewesen ohne die Ausbeutung der fossilen Wälder, die in Jahrmillionen Erdgeschichte wuchsen und deren Verbrennung nun die Ökosysteme der Welt in die Klimakatastrophe treibt. Seit dies nicht mehr zu leugnen ist, sind große technische Fortschritte gemacht worden, aber alle Minderungen des Energieverbrauchs durch technische Innovation und erneuerbare Energien werden durch das global anhaltende Wachstum von Produktion und Konsum aufgefressen.
Die sozialen Folgen des ungleichen Handels
Gegen eine Beschränkung dieses Wachstums aber stehen seine beiden mächtigen Treiber: der Wachstumszwang des Kapitals – und die ungleiche Verteilung von Wohlstand und Lebenschancen. Nicht nur in den Wohlstandssregionen, sondern schärfer noch in den Schwellenländern und den armen Regionen der Welt. Mit gewissem historischen Recht blockieren diese, wenn die Klimaretter des Nordens ihnen nun zur Rettung der Atmosphäre egalitäre CO2-Reduktionsziele aufzwingen wollen. Und schließlich haben wir im vergangenen Jahr einen ersten Vorgeschmack von dem erlebt, was auf uns zukommt, wenn sich Millionen von Menschen aus den elenden Weltregionen auf den Weg machen. Sie folgen den Versprechen der Globalisierung und den medialen Bildern einer globalisierten Konsumkultur, sie fliehen vor den Klimaschäden, vor den sozialen Folgen des ungleichen Handels, vor dem Landhunger des Nordens. Sie flüchten vor Kriegen, an deren Ausbruch und Verschärfung nicht nur vormoderne Stammesmentalitäten und Religionen mitwirken, sondern ebenso das Erbe des Imperialismus und der Ölhunger der westlichen Welt. Das Anthropozän – es könnte ein dunkles Zeitalter werden, und „Zeitalter der Menschheit“ ein schlimmer Euphemismus und eine Abstraktion. Denn das ist der Grundwiderspruch der Epoche, in der wir leben: Wir haben jede Menge Probleme, die das Leben aller Menschen betreffen, aber die Menschheit ist kein handlungsfähiges Subjekt. „Wer Menschheit sagt, will betrügen“, so formulierte es der konservative Staatsrechtler Carl Schmitt. Und er fügte hinzu: In Wirklichkeit gehe es um die Frage, „welchen Menschen die furchtbare Macht, die mit einer erdumfassenden wirtschaftlichen und technischen Zentralisation verbunden ist, zufallen wird.“ Viel spräche also dafür, nicht Anthropozän zu sagen, sondern: Kapitalozän – wenn das Wort nicht ein noch größeres Ungetüm wäre. Denn nicht „der Mensch“ und auch nicht „die Menschen“ haben die Oberfläche der Welt, die sozialen Beziehungen und das Begehren der Menschen umgeformt. Die Arbeit von Menschen hat sie ins Werk gesetzt, aber die Kapitalmächte bestimmen bis heute die Richtung und das Tempo dieser Veränderungen. Nicht die Technik hat die Grundlagen der Zivilisationen- die Erde, die arbeitenden Menschen und die Institutionen geformt, sondern die Art ihrer Anwendung, nicht die Produktivkräfte, sondern die Produktionsweise. Und das Mantra dieser Produktionsweise heißt unendliches Wachstum. Es ist ein utopisches Mantra, denn es verwandelt die Orte, die Institutionen und die Lebenswelt der Menschen, in U-Topien, in Un-Orte: Die Nation wird vom Gefäß der Gesellschaft zum Standort globaler Konkurrenzkämpfe; das Parlament vom Ort, an dem Bürger beschließen, wie sie leben wollen, zum Notariat für die Investorenimperative; Städte, Regionen, Fabriken werden zu Transit-Räumen, belebt oder entwohnt nach der Logik des Kapitals, die Familien zum Ort, an dem „Humankapital“ aufgezogen und Kaufkraft generiert wird – einst unübertroffen formuliert vom christlichen Demokraten Friedrich Merz: Die Kinder von heute sind die Mitarbeiter von morgen und die Kunden von übermorgen. Die schönste Eigenschaft des Menschen – seine Fähigkeit zu spielen, zu musizieren, Geschichten zu erzählen oder erzählt zu bekommen – ist zum Geschäftsfeld gigantischer Kapitalien geworden, die die Arenen des Kommerzsports und die Netze der Unterhaltungsindustrie betreiben. Von den christlichen Festen ganz zu schweigen. Und wen das alles traurig macht, selbst der wird noch zum Wachstumsfaktor. Depression ist die zweithäufigste „Krankheit“ – und ein neues, lukratives Geschäftsfeld. Das Ganze ist eine „Teufelsmaschine“ – so sagte es der große bürgerliche Wissenschaftler Max Weber, eine Maschine, die erst zur Ruhe kommen werde, wenn „die letzte Tonne Erz mit der letzten Tonne fossilen Brennstoffs geschmolzen sein wird“. Und diese Teufelsmaschine hat auch die Arbeit selbst verändert, und mit ihr die Menschen. In den vergangenen zwei Jahrhunderten hat sich, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, die qualifizierte Arbeit, die an den Körpern, den Fähigkeiten, den Erfahrungen der Menschen klebte, von ihnen abgelöst. Zunächst bei der Herstellung von Dingen: Die Geschicklichkeit der Hand verschwand in den Maschinen, die Muskeln wurden von Dampfmaschine und Elektrizität ersetzt. Automaten traten an die Stelle von Auge, Tastsinn und Erfahrungswissen. Natürlich war das ein Fortschritt und eine Befreiung von Körper und Seele tötender Plackerei, aber sie hat ihren anthropologischen Preis: Der Mensch als Produzent, als eigenartiges und deshalb eigensinniges Subjekt der Tätigkeit, wird zum flexiblen, passiven Rohstoff der Großen Maschine. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Individuen und die Gesellschaften. Mit der Einführung automatischer oder teilautomatischer Produktionsverfahren in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts spaltete sich die traditionelle Facharbeiterschaft in hoch qualifizierte Spezialisten und austauschbare Bedien- und Hilfskräfte. Aber wer leicht zu ersetzen ist, der verliert seine Verweigerungsmacht. Denn die Räder stehen eben nicht mehr still, wenn „die starken Arme“ es wollen. Und nun, im 21. Jahrhundert, wälzen Informationstechnologie und Internet die Arbeitswelt erneut um. Nicht nur der Hilfsarbeiter im Lager, nicht nur die Kassiererin im Supermarkt werden ersetzbar, sondern auch das Können von Ingenieuren, Architekten und Anwälten ist nun in den Algorithmen der Software gespeichert und abrufbar. Computer stellen medizinische Diagnosen oder organisieren komplexe logistische Abläufe, Algorithmen ersetzen das Ermessen von Verwaltungsangestellten.
Was derzeit
mit dem Schlagwort Industrie 4.0 oder „Internet der Dinge“
bezeichnet wird, signalisiert den Endpunkt dieser Entwicklung. Werkstücke,
die ihren Weg durch die Produktionsabläufe selbsttätig digital
steuern; Verteilungsnetze, die vom voll automatisierten Lager über
selbstlenkende Automobile bis zum Supermarkt fast ohne Menschen auskommen;
Sensorentechnologien, die Störungen erkennen und selbstständig
beheben, smarte Häuser, die ihre Temperatur regeln, Kühlschränke,
die melden, dass die Milch zur Neige geht und eine Bestellung aufgeben,
die von Drohnen ausgeliefert wird; GPS-Systeme, die nicht nur die automatisierten
Landwirtschaftsmaschinen über die quadratkilometergroßen
Felder der Monokulturen steuern, die mir nicht nur den Weg weisen, sondern
auch schnarren, wenn mich ein auf meine Vorlieben passendes Schnäppchen
an der nächsten Ecke erfreuen könnte; die Algorithmen von
Facebook, google, amazon und anderen, die schon heute wissen, was mich
morgen interessiert; Kameras, die Physiognomien und Stimmen analysieren,
um Konsumpräferenzen zu erkunden. All das ist teils noch in Entwicklung,
teils durchdringt es schon heute unseren Alltag. Business at the speed
of thought, so hat Bill Gates diese schöne neue Welt vor zwei Jahrzehnten
vorausvisioniert: Produktion und Distribution in der größten
Geschwindigkeit, zu den geringsten Kosten und mit den wenigsten beteiligten
Menschen. Es gibt keine zuverlässigen Prognosen über das Ausmaß
an Arbeitslosigkeit, das daraus folgen wird. Für die USA und für
Deutschland gibt es Schätzungen, dass in den nächsten Jahrzehnten
50 Prozent der Arbeitsplätze durch das Vordringen der sogenannten
künstlichen Intelligenz wegrationalisiert werden könnten.
Niemand kann Zuverlässiges sagen, denn die wichtigste Größe
für die Geschwindigkeit des Vormarschs der Automaten und Roboter
wird der Preis der menschlichen Arbeit sein: sinkt er, lohnen sich die
Maschinen nicht, steigt er, wird – wo immer es geht – rationalisiert.
Noch schleppen – so zeigt es ein Foto dieser Tage – Tausende
von Trägern in geschulterten Kiepen Kohle aus den chinesischen
Tagebauten womöglich, um die Elektrizität zu produzieren für
die Herstellung von Computern, die in den Konsumzonen der Welt das Leben
von manueller Arbeit befreien. Noch lagern Handelsriesen wie amazon
einfache Tätigkeiten wie Adressensuchen an digitale Stücklohnarbeiter
aus – mechanische Türken, wie sie ganz offiziell heißen
– die für Stundenlöhne von drei Euro in einem weltweiten
Netz ackern – ohne die Möglichkeit, sich zu organisieren.
Könnten sie es: Die Antwort wäre die nächste Generation
von Automaten. Technologische Optimisten verkünden wie immer: Mit
der Automatisierung fielen zwar Arbeitsplätze weg, aber im selben
Maß entstünden neue Tätigkeitsfelder. Besonders menschenfreundlich
klingt das Argument: Durch die Rationalisierung würden Arbeitskräfte
frei, vorzüglich für Dienstleistungen – ob nun in der
Gastronomie, im Gesundheitswesen, in der Betreuung von Alten oder Kindern
oder im Haushalt. Aber auch die stehen unter Kosten- und Profitdruck;
bereits heute analysieren Algorithmen die Pflege in Krankenhäusern:
Männer brauchen weniger pflegerische Zuwendung, Frauen zwischen
35 und 45 am meisten – alles wird auf die Minute berechnet, die
Krankenschwestern tragen Sensoren, die ihre Zuwendungszeit optimal programmieren.
Es fällt dem Denken nicht schwer, sich einen Endzustand vorzustellen,
in dem homo faber, das werkzeugproduzierende Tier, nur noch der flüssige
Rohstoff, das Gleitmittel der großen Automaten ist. Die Philosophin
Hannah Arendt schrieb schon vor einem halben Jahrhundert: „In ihrem
letzten Stadium verwandelt sich die Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft
von Jobholdern, und dieses verlangt...kaum mehr als ein automatisches
Funktionieren. Und so endet die Neuzeit in der tödlichsten, sterilsten
Passivität, die die Geschichte je gekannt hat. [...] Arbeit und
die in ihr erreichbare Lebenserfahrung wird zunehmend aus dem menschlichen
Erfahrungsbereich ausgeschaltet sein.“ Und Arendts knappes Résumé:
„Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, entwickeln wir
uns zurück. In eine Tiergattung.“ Das Anthropozän –
in solcher Perspektive wäre es die Epoche des Abschieds vom Menschenbild
nicht nur der Neuzeit, sondern auch des homo sapiens. Die Werkzeuge,
die er geschaffen hat, wären zum gigantischen Apparat einer zweiten
Natur geworden, und sein Schöpfer zum „Knotenpunkt konventioneller
Reaktionen und Funktionsweisen zusammenschrumpfen, die sachlich von
ihm erwartet werden.“ Das ist der Befund von Horkheimer und Adornos
Dialektik der Aufklärung. An Schwarzen Utopien ist kein Mangel.
Aber wie steht es um die Gegenkräfte? Sie sind so alt wie die westliche
Neuzeit. Ihre Geschichte, sagen wir realistischerweise ihre Geistesgeschichte,
ist voll von road maps für den Weg in ein „Anthropozän“,
das zu Recht ein „Zeitalter der Menschen“ genannt werden könnte.
Das reicht von Immanuel Kants aufgeklärter Idee einer föderalistischen
Weltrepublik, die Ernst mit dem kategorischen Imperativ machte; und
mit dem Gedanken, dass die „Oberfläche der Erde“ zu gleichen
Teilen das Eigentum aller Menschen ist bis zu den Blaupausen für
eine „Große Transformation“, für globale "New
Deals" und Klimabündnisse unserer Tage. Vom italienischen
Mönch Campanella im 16. Jahrhundert über die bürgerlichen
Ökonomen des 19. bis zum großen John Maynard Keynes und den
Technologie-Hippies an der kalifornischen Küste im 20. Jahrhundert
war die Entfesselung der menschlichen Produktivität nie ein Selbstzweck,
sondern ein Mittel zum wirklichen Reichtum, dem Reichtum an Lebenszeit
und der Freisetzung für höhere Tätigkeiten, für
Muße, menschliche Begegnungen, Spiel, Naturgenuss, Meditation.
Automation – auch für Karl Marx war sie ein Werkzeug der Befreiung.
Und sein Anthropozän war eine Gesellschaft, die „ihren Stoffwechsel
mit der Natur rationell regelt und unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle
bringt, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden,
ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen
Natur würdigsten Bedingungen vollzieht“. Kein Schlaraffenland,
sondern ein „Reich der Notwendigkeit“, jenseits desselben
erst das Reich der Freiheit blühen könne. Dessen Grundbedingung
aber sei die „Verkürzung des Arbeitstags“. 100 Jahre
lang war diese auch die Vision der organisierten Arbeiterschaft. Heute
kämpft keine Gewerkschaft mehr dafür und das Ideal der allseitigen
Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten – es klingt altbacken
und abwegig in einer Zeit, in der in Europa der Kampf um den Achtstundentag
wieder aktuell wird – als wäre 100 Jahre nichts geschehen;
in einer Zeit, in der wir die Bildungsrepublik ausrufen, aber Millionen
von jungen Menschen ohne Arbeit, ohne Bildung und damit ohne Zukunft
auf den freien Markt entlassen.
Die Vision von der solaren Weltgesellschaft
Bildung aber ist die wichtigste Ressource der Zukunft, wenn auch nicht die Verallgemeinerung des Bildungsbürgertums, von der die humanistischen Ökonomen der Vergangenheit und die gymnasialen Studienräte bis vor kurzem noch träumen mochten. Heute geht es darum, ein massenhaftes Bewusstsein für die Notwendigkeit einer zivilisatorischen Wende und die Qualifikationen für ihre Durchsetzung zu entwickeln. Denn das Aufgabenbuch für das Anthropozän ist umfassend und erschreckend. Die Vermeidung einer geohistorischen Katastrophe – das ist die dringlichste, aber nicht die einzige Aufgabe. Es geht um nichts weniger als um das Management der Atmosphäre und eine Art globaler Verwaltung des natürlichen und moralischen Menschheitserbes. Die Fruchtbarkeit der Böden, die Ergiebigkeit und Sauberkeit der Meere, die Rettung der Fauna, der Schutz vor neuartigen Epidemien, die Menschenrechte, die Frauenrechte, der gleiche Zugang zu den Technologien der Gesundheit, der Kultur, die Teilhabe an den Produkten der Arbeit – das sind nur einige der Probleme, die a tempo in Angriff genommen werden müssen, wenn dieses Jahrhundert nicht im Kampf aller gegen alle enden soll. Das ist nichts weniger, wenn man es zusammendenkt, als der Übergang in eine neue, postkapitalistische Produktionsweise. Eine Epochenwende, und noch dazu eine globale aber kann man nicht politisch dekretieren oder technokratisch planen. Auch heute reden Philosophen angesichts der Problemlage zwar von der Notwendigkeit einer Weltregierung. Auf dem Weg zu einer „bewussten Gesamtregierung“ auf globalem Maßstab aber, so warnte vor dem Jahrhundert der Weltkriege Friedrich Nietzsche, würde sich die Menschheit zugrunde richten. Nur ein allgemeines Bewusstsein für die Bedingungen einer neuen Kultur könne eine „ökumenische“ Praxis begründen. Hunderttausende von Nichtregierungsorganisationen, die seit den 70er-Jahren entstanden sind und die gegen die Verwüstung der Erde, gegen das Artensterben ebenso wie gegen unerträgliche Arbeitsbedingungen und für globalen Reichtumsausgleich, fairen Handel und Gemeineigentum am natürlichen und kulturellen Erbe der Menschheit eintreten – sie sind der Anfang einer solchen Ökumene – der Selbstaufklärung, des Lernens, des Gründens. Archen der Zukunft im Strudel der Klima-, der Finanz-, der Hunger- und der politischen Krisen. Oder, um das Bild technologisch auf die Höhe der Zeit zu bringen: Insassen des Raumschiffs Erde, die wissen, dass die Fahrt in die Zukunft nur gelingen kann, wenn die Passagiere den Proviant gerecht teilen und mit dem Treibstoff haushalten. Wollte man einen alles überspannenden Namen, ein gemeinsames Ziel für diese vielfältigen Aufbrüche finden, dann wäre es vielleicht: die Solare Weltgesellschaft. Eine Vision, die weit mehr umfasst als die Ersetzung fossiler durch Erneuerbare Energien: den Übergang zu einer Wirtschaftsweise, die das gemeinsame Erbe der Menschheit verwaltet, zu einer Lebensweise, deren ökologischer Fußabdruck mit dem Fortbestand der Erde vereinbar ist. Die jüngste technologische Revolution könnte diese Befreiung fördern. Algorithmen und Computernetzwerke können Menschen kontrollieren, destruktive Bedürfnisse wecken, Wachstum hochpeitschen, Drohnen lenken, jedes Jahr neue Generationen virtueller Welten und Spaßmaschinen entwerfen und vertreiben, Menschen zum passiven Gleitmittel einer amoklaufenden Wirtschaft degradieren. Aber Algorithmen und Computer können auch von harter, routinierter, geistloser Arbeit befreien, sie können die Umstellung von Energiezentralen auf dezentrale vernetzte Einrichtungen regeln, sie können öffentliche Verkehrsmittel attraktiv machen, die Systeme der Steuererhebung gerechter transparenter und effizienter machen, das Wissen der wirklichen Welt allen zugänglich machen – und so Zeit gewinnen für die Arbeit am Anthropozän. Es ist so viel von Freiheit und Individualität die Rede, wenn in diesen Tagen – gegen die drohende Invasion der Barbaren und gegen den Verfall der zivilgesellschaftlichen Werte – von allen Seiten das „Menschenbild Europas“ beschworen wird. Von einem europäischen Wert ist dabei, wenn ich mich nicht täusche, selten die Rede. Dabei ist er konstitutiv – für die Individualität jedes Einzelnen und für die Freiheit aller: Der Mensch, so gilt es seit Aristoteles, ist von Natur und Geschichte ein zoon politicon, ein soziales und politisches Wesen, ein geselliges und ein Gesetze machendes Tier. Zur europäischen Idee des guten Lebens gehörte seit Beginn der Neuzeit die Abschaffung des Mangels durch Arbeit, Wissenschaft und Technik. Und dies zur Erleichterung des Lebens, zum Genuss der Kultur und zur Befähigung aller Menschen zur Teilnahme an der Gestaltung und Verwaltung des Gemeinwesens und seiner Institutionen. Alle Menschen sollen gleichberechtigte Bürger werden können, auch die „zweibeinigen Werkzeuge“, an deren Emanzipation der Sklavenbesitzer Aristoteles und die Denker des 18. Jahrhunderts noch nicht dachten. Angesichts der Skepsis auch der informiertesten Bürger, ob ihre Repräsentanten die Gestaltungsmacht über die Form der zukünftigen Technik und Lebenswelt gegen die global agierenden privatwirtschaftlichen Konzerne, Kartelle und Finanzoligarchien zurückgewinnen können; angesichts des anschwellenden, dumpfen Zweifels, ob sie das überhaupt noch wollen; angesichts der grassierenden Furcht vor einem technischen Totalitarismus und angesichts der hartnäckigen Furcht vor Konsumbeschränkung in den reichen Ländern ist die wichtigste Arbeit im Anthropozän die Instandbesetzung der erodierenden demokratischen Institutionen auf allen Ebenen. Und die wichtigste, aber derzeit knappste Ressource dafür, die Neugier, der Optimismus, die Wut und die Energie des zoon politicon. Und die optimistischste Hoffnung ist diejenige, dass es sich dabei um eine demokratische, dezentrale, erneuerbare und rechtzeitig nachwachsende Energie handelt. Und wer soll das alles machen, diese Instandbesetzung? Auf diese Frage pflegte der französische Soziologe und Aktivist Pierre Bourdieu zu sagen: „Ach, Sie fragen nach dem historischen Subjekt? Nun, das sind diejenigen, die es machen.“
![]() Essay
und Diskurs im Deutschlandfunk
Essay
und Diskurs im Deutschlandfunk
Müssen wir umdenken – und wenn ja, wie? Rudi Netzsch 11/2021
Wie gesellschaftliche
Verhältnisse unser Handeln und Denken bestimmen. Und wie wir uns
des Wandels bewusst werden können. Eine philosophiegeschichtliche
Anmerkung
Ein "Umdenken" zu fordern, ist eine heutzutage sehr geläufige
Art der Gesellschaftskritik. Zugleich ist es Idealismus pur: Die Gesellschaft
ist so, wie sie ist, weil die Leute so denken, wie sie denken; um die
Gesellschaft zu ändern, ist dieser Auffassung nach nichts weiter
nötig, als das Denken zu ändern.
Es hilft wenig, dem nur gleichsam als Glaubenssatz entgegenzuhalten,
dass das gesellschaftliche Sein das Denken bestimme, denn um zu überzeugen,
muss man auch Gründe angeben, zumal Marx' Satz von der Bestimmtheit
des Denkens durch das Sein mit dem entscheidenden Hinweis versehen werden
muss, dass das Denken sehr wohl frei ist, über die gegebenen Verhältnisse
hinauszugehen, also Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Veränderung
zu gewinnen.
Es ist nur so, dass das allein die Verhältnisse noch nicht ändert:
dazu ist bewusste kollektive Aktion nötig, oder um mit Marx zu
sprechen: "auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald
sie die Massen ergreift." (MEW Bd. 1, S. 385) Für eine überzeugende
Kritik des Idealismus des "Umdenkens" wollen wir dem historischen
Entstehungsweg der materialistischen Gesellschaftskritik folgen, denn
so wird deren logische Notwendigkeit deutlich.
Wir beginnen
mit der Zeit der Aufklärung. Aus Sicht der damaligen Denker war
die Kritik an den Institutionen des Feudalismus gleichbedeutend mit
einer Kritik "künstlicher" Verhältnisse im Gegensatz
zu "natürlichen"; befreien sich die Menschen aus den
künstlichen Fesseln der überkommenen Gesellschaftsordnung,
so können sie, allein ihrer Vernunft folgend, eine "natürliche"
Gesellschaft errichten. So wird Gesellschaft als Ansammlung vieler Einzelner
verstanden, die sich vernunftgemäß, etwa durch einen Gesellschaftsvertrag,
eine dem Wohl aller dienende Ordnung geben könnten.
Entspricht das nicht dem Standpunkt, der heute mit der Parole vom "Umdenken"
ausgesprochen wird? Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen
kommen als Forderungen an das Verhalten, also die Moral der Einzelnen
daher.
Die Denker der Aufklärung wandten sich gegen die tradierten, vor
allem religiösen Begründungen für die feudalen Verhältnisse
und forderten dazu auf, sich stattdessen gemäß "natürlichen"
Grundsätzen zu verhalten.
Daher galt es, insbesondere die Ethik aus den allgemeinen Bestimmungen
des Menschen abzuleiten, wobei klar war, dass nicht alles, was in den
Trieben und Anlagen des Menschen liegt, auch unmittelbar als moralischer
Leitfaden taugen kann. Das konnte in verschiedenen Varianten ausgesprochen
werden: einerseits, indem im Anschluss an Hobbes das Schlechte im Menschen
betont wird, das in Zaum gehalten werden müsste; andererseits,
indem mit Rousseau die Menschen für von Natur aus gut befunden,
und das Böse als Folge der verkehrten, d.h. feudalen Verhältnisse
begriffen wird. In beiden Fällen geht es darum, dass die Moral
das Böse beschränken müsse und dabei durch staatliche
Sanktionen bestärkt werde.
Immanuel Kant ![]() Das
Zeitalter der Aufklärung mehr
Das
Zeitalter der Aufklärung mehr ![]() Archiv
Archiv
Kant, dessen Kritik der praktischen Vernunft allgemein als Endpunkt
der Moralphilosophie der Aufklärung gesehen wird, fasst dies sehr
radikal, indem er nur die Vernunft als Grundlage moralischer Gesetze
gelten lässt, da die anderen natürlichen Bestimmungen des
Menschen gerade das seien, was gegebenenfalls durch die Moral beherrscht
werden müsse. Vielmehr müsse, wie es in der Vorrede zur Grundlegung
der Metaphysik der Sitten heißt "der Grund der Verbindlichkeit
nicht in der Natur des Menschen, oder den Umständen in der Welt,
darin er gesetzt ist, gesucht werden, sondern a priori lediglich in
Begriffen der reinen Vernunft." (S. 13)
Nur in Bezug auf ihre Anwendung seien empirische Aspekte einzubeziehen,
indem die "Gesetze a priori freilich noch durch Erfahrung geschärfte
Urteile erfordern, um teils zu unterscheiden, in welchen Fällen
sie ihre Anwendung haben, teils ihnen Eingang in den Willen des Menschen
und Nachdruck zur Ausübung zu verschaffen, da diese, als selbst
mit so viel Neigung affiziert, der Idee einer praktischen reinen Vernunft
zwar fähig, aber nicht so leicht vermögend ist, sie in seinem
Lebenswandel in concreto wirksam zu machen" (ebd).
Damit ergibt sich der Widerspruch zwischen der allergrößten
Allgemeinheit der Grundlagen und dem Anspruch, daraus Handlungsanweisungen
in jeweils ganz speziellen praktischen Situationen abzuleiten. Kant
formuliert bekanntlich einen obersten moralischen Grundsatz, aus dem
sich alle weiteren Regeln ableiten lassen sollen, nämlich den Kategorischen
Imperativ. Um als oberster Grundsatz über allen möglichen
besonderen Anwendungsfällens stehen zu können, muss dieser
von der höchsten denkbaren Allgemeinheit sein; er lautet:
Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
Immanuel Kant
Um auf dieser Grundlage eine einzelne Handlung moralisch zu beurteilen,
sind drei Schritte erforderlich:
Erstens: zu der Maxime zu kommen, unter der die Handlung zu subsumieren
ist.
Zweitens: diese Maxime (also das subjektive, persönliche Prinzip)
als objektives, allgemeingültiges Gesetz auszusprechen.
Drittens: zu beurteilen, ob dieses allgemeine Gesetz Bestand haben kann.Diese
drei Schritte bergen Probleme, die den Anspruch, eine allgemein praktikable
Begründung der Moral a priori zu deduzieren, infrage stellen können.
Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – behandelt Kant
dies eher als Trivialität:
Welche Form in der Maxime sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicke,
welche nicht, das kann der gemeinste Verstand ohne Unterweisung unterscheiden.
An anderer Stelle spricht er sogar davon, dass selbst ein Kind "von
etwa acht oder neun Jahren" (Über den Gemeinspruch…,
S.132) die nötigen Schlüsse ziehen könne.
Zur ersten Frage: Wie kommt man zu Maximen? Die Maxime ist gegenüber
der einzelnen Handlung ein Allgemeines; es muss also die einzelne Handlung
unter einen allgemeinen Begriff subsumiert werden. Als Zwischenglied
zwischen der einzelnen Handlung und der allgemeinen Maxime ist die Besonderheit
eines Begriffs erforderlich.
Ein solcher Begriff muss sich auf die den Gesellschaftsmitgliedern gemeinsamen
Verhältnisse beziehen - und damit ist die Maxime, zumal wenn sie
als allgemeines Gesetz gefasst wird, gewöhnlich schon mit diesem
Begriff gegeben: Man muss Schulden begleichen? Klar, wenn man sie nicht
begleichen müsste, wären es keine Schulden! Man muss Eigentum
respektieren? Klar, sonst wäre es kein Eigentum.
In diesem Zusammenhang ist das von Kant in der Kritik der praktischen
Vernunft (S. 136) aufgeführte Beispiel des Depositums aufschlussreich.
Auch hier könnte man einfach formulieren: "Man darf ein Depositum
nicht unterschlagen" und darauf verweisen, dass das schon im Begriff
des Depositums liegt. Kant spricht es nicht in dieser unmittelbar tautologischen
Form aus, sondern bemüht sich um den Nachweis, dass die Negation
dieser Maxime sich selbst ad absurdum führen würde.
Er beginnt damit, dass die bloße Habgier nicht als Maxime zum
allgemeinen Gesetz erhoben werden könne, da sie sich in Interessenkollisionen
aufheben würde; sodann nimmt er explizit den Begriff des Depositums
in die Maxime auf, und weist darauf hin, dass eine Maxime, die das Einbehalten
von Depositen erlaubt, daran gebunden sein müsste, dass dies "sicher"
geschehen kann, indem sie nur für Fälle anzuwenden sei, in
welchen die Hinterlegung des Depositums nicht beweisbar sei, womit er
– nebenbei bemerkt – doch wieder die Empirie in Gestalt der
gesellschaftlichen Verhältnisse, die gegebenenfalls zu Strafverfolgung
und Reputationsverlust führen, unter der Hand voraussetzt.
Schließlich kommt er zum Schluss, dass eine solche Maxime zum
allgemeinen Gesetz erhoben "sich selbst vernichten würde,
weil es machen würde, dass es gar kein Depositum gäbe."
(Kritik d. pr. V., S.136). Was hier wie eine simple Schlussfolgerung
präsentiert wird, ist keineswegs einfach und bezieht allerlei gesellschaftliche
Verhältnisse als gegeben mit ein.5 In der Schrift Über den
Gemeinspruch … schmückt Kant dasselbe Beispiel weiter aus:
Der Inhaber des Depositums sei ein Menschenfreund und Wohltäter,
der jedoch unverschuldet in Not geraten seine Familie kaum ernähren
könne, wohingegen die Erben des Eigentümers derart üppig
und verschwenderisch leben, "dass es ebenso gut wäre, als
ob dieser Zusatz zu ihrem Vermögen ins Meer geworfen würde."
(Gemeinspruch, S. 132)
Da ist schon zu fragen, ob denn nicht in den in dieser Ausschmückung
genannten Umständen Begriffe aufgefunden werden könnten, die
sich für eine alternative, ebenso zum Gesetz erhebbare Maxime eignen
würden. Kant sagt indessen nur lapidar:
Und nun frage man, ob es unter diesen Umständen für erlaubt
gehalten werden könne, dieses Depositum im eigenen Nutzen zu verwenden.
Ohne Zweifel wird der Befragte antworten: Nein! und statt aller Gründe
nur bloß sagen können: es ist unrecht , d.i. es
widerspricht der Pflicht. (ebd., Herv. im Orig.)
Georg
Wilhelm Friedrich Hegel ![]() Archiv
Archiv
![]() Faust in Analogie zu Hegels Hauptwerken
Faust in Analogie zu Hegels Hauptwerken
Hegel bezieht sich in seiner Kritik an Kants Moralphilosophie auf diese
mangelnde Vermittlung zwischen dem bestimmten Inhalt der Maximen und
der allgemeinen Form des Gesetzes - und hier liegt, wie sich zeigt,
auch der Schlüssel zur Frage, wieso Hegel keine "Ethik"
hinterlassen hat, sondern deren Stelle durch seine Rechtsphilosophie
eingenommen wird.
Wie kommt das? In seiner frühen Schrift Über die wissenschaftlichen
Behandlungsarten des Naturrechts findet sich eine kritische Auseinandersetzung
mit Kants kategorischem Imperativ. Darin bezieht sich Hegel auch auf
das Depositum-Beispiel und merkt dazu an: "Dass es aber gar kein
Depositum gäbe, welcher Widerspruch läge darin?" (S.
462)
Ein Widerspruch, so fährt er fort, könnte sich sehr wohl aus
anderen "notwendigen Bestimmtheiten" und "Zusammenhängen"
ergeben, indem diese die Möglichkeit von Depositen erfordern. Jedoch:
"Aber nicht andere Zwecke und materielle Gründe sollen herbeigerufen
werden, sondern die unmittelbare Form des Begriffs soll die Richtigkeit
der ersten oder zweiten Annahme (nämlich, dass es Depositen gäbe
oder nicht) entscheiden" (ebd.) Im Anschluss führt Hegel denselben
Gedanken allgemein hinsichtlich des Eigentumsverhältnisses aus:
Wenn die Bestimmtheit des Eigentums überhaupt gesetzt ist, so lässt
sich der tautologische Satz daraus machen: das Eigentum ist Eigentum
und sonst nichts anderes, und diese tautologische Produktion ist das
Gesetzgeben dieser, der praktischen Vernunft: das Eigentum, wenn Eigentum
ist, muss Eigentum sein.
Hegel führt weiter aus, dass in derselben Form auch das Gegenteil
gedacht werden kann:
Aber ist die entgegengesetzte Bestimmtheit, Negation des Eigentums gesetzt,
so ergibt sich durch die Gesetzgebung ebenderselben praktischen Vernunft
die Tautologie: das Nichteigentum ist Nichteigentum; wenn kein Eigentum
ist, so muss das, was Eigentum sein will, aufgehoben werden.
Die in ihrer rein negativen Abstraktheit ein wenig befremdlich klingende
Rede vom "Nichteigentum" gewinnt eine unerwartete Anschaulichkeit,
sobald man sich aus der Vorstellungswelt der kapitalistischen, durch
und durch auf Privateigentum gegründeten Gesellschaften löst.
So berichten Ethnologen, die sich bei Naturvölkern aufgehalten
haben, "über deren unbefangenes und ausdauerndes Schnorren
– und auch über deren eigenwilliges Verständnis von Eigentum,
als sie erlebten, wie ihre persönlichen Kleidungsstücke ohne
Absprache von Einheimischen getragen wurden." (Asenhuber 2021)
Die Rede ist hier von Jäger-und-Sammler-Völkern, deren Gesellschaft
kein Eigentum in unserem Sinn kennt und denen deshalb auch nicht unsere
Moralvorstellung hinsichtlich des Eigentums geläufig sind. Ebenso
würde es in einer auf Gemeinschaftseigentum beruhenden Hirtengesellschaft
als unmoralisch (wenn nicht einfach als verrückt) empfunden, wenn
ein Stammesangehöriger auf die Idee käme, bestimmte Tiere
der gemeinsamen Herde für sich exklusiv zu beanspruchen, oder gar
ein Grundstück als Weide für "seine" Tiere abzugrenzen
und einzuzäunen.
Hegel betont also, dass aus dem bloßen Begriff eines allgemeinen
Gesetzes die besondere Kategorie Eigentum nicht abgeleitet werden kann.
Wenn er nun schreibt "Aber es ist gerade das Interesse, zu erweisen,
dass Eigentum sein müsse" (S. 463), so benennt er nur das,
was Kant ohne Beweis voraussetzt, zieht es aber selbst ebenfalls nicht
in Zweifel.
Jedoch hat sich damit die Frage grundlegend geändert: Jetzt geht
es darum, die bestimmten Verhältnisse, auf die sich moralische
Maximen und Gesetze beziehen, zu begründen; die moralischen Schlussfolgerungen
sind in diesen dann ja enthalten. Gegenstand ist also nicht mehr eine
Ethik, in der allgemeine moralische Grundsätze hergeleitet werden,
sondern das, was nun Inhalt seiner "Philosophie des Rechts"
ist.
Er will die gesellschaftlichen Verhältnisse, von der Familie über
die bürgerliche Gesellschaft bis zum Staat, als notwendig darstellen,
wobei – und insofern setzt er immer noch das Anliegen der Aufklärung
fort – sich deren Notwendigkeit aus den Bestimmungen der Logik,
also der Vernunft ergeben soll. Eine separate Ethik erübrigt sich,
wie er in der Einleitung zur Rechtsphilosophie anmerkt:
Ohnehin über Recht, Sittlichkeit, Staat ist die Wahrheit ebensosehr
alt als in den öffentlichen Gesetzen, der öffentlichen Moral
und Religion offen dargelegt und bekannt. Was bedarf diese Wahrheit
weiter, insofern der denkende Geist sie in dieser nächsten Weise
zu besitzen nicht zufrieden ist, als sie auch zu begreifen und dem schon
an sich selbst vernünftigen Inhalt auch die vernünftige Form
zu gewinnen […]. Das einfache Verhalten des unbefangenen Gemütes
ist es, sich mit zutrauensvoller Überzeugung an die öffentlich
bekannte Wahrheit zu halten und auf diese feste Grundlage seine Handlungsweise
und feste Stellung im Leben zu bauen.
In der Zielsetzung, die gesellschaftlichen Verhältnisse aus reinen
Prinzipien der Vernunft abzuleiten, ist also Hegels "berühmt-berüchtigter"
Satz von der Vernünftigkeit alles Wirklichen schon angelegt. Kritik
an den Verhältnissen betrifft nach Hegel nur deren unvollkommene
Ausprägung, nicht die in ihnen enthalte Idee. "So soll denn
diese Abhandlung, insofern sie die Staatswissenschaft enthält,
nichts anderes sein als der Versuch, den Staat als ein in sich Vernünftiges
zu begreifen und darzustellen." (Rechtsphilosophie S.57)
Karl Marx
Marx, der nach eigenem Bekunden während seiner Studentenzeit im
Bann von Hegels Philosophie stand, wurde bald zu einem seiner entschiedensten
Kritiker. In seinem unvollendeten, posthum herausgegebenen Manuskript
Kritik des Hegelschen Staatsrechts schreibt er:
Man hat Hegel vielfach angegriffen über seine Entwicklung der Moral.
Er hat nichts getan, als die Moral des modernen Staats und des modernen
Privatrechts entwickelt. […] Es ist vielmehr ein großes,
obgleich nach einer Seite hin (nämlich nach der Seite hin, dass
Hegel den Staat, der eine solche Moral zur Voraussetzung hat, für
die reale Idee der Sittlichkeit ausgibt) unbewusstes Verdienst Hegels,
der modernen Moral ihre wahre Stellung angewiesen zu haben.
MEW 1, 313
Das ist eine der wenigen Stellen in dieser Schrift, wo Lob über
Hegels Philosophie anklingt; das Lob bezieht sich auf die Erkenntnis,
dass die Moral nur ausspricht, was in den Verhältnissen der bürgerlichen
Gesellschaft und ihres Staats begrifflich schon enthalten ist, sowie
auf die systematische Ordnung, in der er diese Verhältnisse darstellt.
Allerdings kritisiert Marx die von Hegel gegebenen Begründungen
und Ableitungen durchgehend und grundsätzlich. Denn Hegel stellt
die Sache stets so dar, als wären Gesellschaft und Staat selbst
nichts anderes als die Realisierung der sittlichen Idee, wobei "Realisierung
der Idee" nicht so zu verstehen ist, dass jemand das, was er im
Geist erdacht hat, also eine "Idee" im alltagssprachlichen
Sinn, in die Realität umsetzt, sondern so, dass die Idee als logische
Wesenheit selbst es sein soll, die sich da realisiert.
Die ganze Ableitung der gesellschaftlichen Verhältnisse von der
Familie über die bürgerliche Gesellschaft bis zum Staat erscheint
demgemäß als nichts anderes als die stufenweise Selbstverwirklichung
der logischen Idee.
Nicht die Logik der Sache, sondern die Sache der Logik ist [bei Hegel]
das philosophische Moment
MEW 1, 216
Jedoch: wie soll der bestimmte Inhalt der gesellschaftlichen Verhältnisse
sich aus den ganz allgemeinen Formen der Logik begründen lassen?
Man steht auch hier wieder – nicht anders als wir es bei Kant gesehen
haben – vor der Frage, wie sich die Besonderheiten aus der Allgemeinheit
der reinen Vernunft ableiten lassen sollen; es überrascht also
nicht, wenn sich die betreffenden Argumente in Hegels Rechtsphilosophie
bei genauerem Hinsehen als – man kann es so nennen – rhetorische
Tricks erweisen, mit welchen unter der Hand der gewünschte Inhalt
hineingeschmuggelt wird. Marx stellt diese Kritik mehrfach anhand einzelner
Textstellen dar, etwa wenn er zitiert
§262. Die wirkliche Idee, der Geist, der sich selbst in die zwei
ideellen Sphären seines Begriffs, die Familie und die bürgerliche
Gesellschaft, als in seine Endlichkeit scheidet, um aus ihrer Idealität
für sich unendlicher wirklicher Geist zu sein, teilt somit diesen
Sphären das Material dieser seiner endlichen Wirklichkeit, die
Individuen als die Menge zu, so dass diese Zuteilung am Einzelnen durch
die Umstände, die Willkür und eigene Wahl seiner Bestimmung
vermittelt erscheint.
und dazu schreibt:
Der Staat ist es, der sich in sie [die beiden Sphären] scheidet
[…], und zwar tut er dieses, "um aus ihrer Idealität
für sich unendlicher, wirklicher Geist zu sein". "Er
scheidet sich um." Er "teilt somit diesen Sphären das
Material seiner Wirklichkeit zu, so dass diese Zuteilung etc. vermittelt
erscheint" Die sogenannte "wirkliche Idee" […] wird
so dargestellt, als ob sie […] zu bestimmter Absicht handle. Sie
scheidet sich in endliche Sphären, […] und sie tut dies zwar
so, dass das gerade ist, wie es ist.
MEW 1, 205, Hervorhebungen im Original
Das "und sie tut dies so, dass das gerade ist, wie es ist"
bezeichnet den rhetorischen Trick: alles, was Bezug zum tatsächlich
betrachteten Gegenstand, also der bürgerlichen Gesellschaft hat,
wird einfach aus der Realität aufgenommen, aber dann in dieser
verkehrten Weise als Ausfluss der Selbstbewegung der Idee besprochen.
Oder, wie Marx weiter schreibt:
Die Wirklichkeit wird nicht als sie selbst, sondern als eine andere
Wirklichkeit ausgesprochen. Die gewöhnliche Empirie hat nicht ihren
eigenen Geist, sondern einen fremden zum Gesetz, wogegen die wirkliche
Idee nicht eine aus ihr selbst entwickelte Wirklichkeit, sondern die
gewöhnliche Empirie zum Dasein hat.
MEW 1, 206
Dieses Verfahren eröffnet die Freiheit, alles - was auch immer
sein spezifischer Inhalt sein mag - in dieser Weise "herzuleiten",
denn es genügt, die Realität einfach als das zu benennen,
wofür die Entwicklung der Logik im jeweiligen Fall stehen soll:
Das einzige Interesse ist, "die Idee" schlechthin, die "logische
Idee" in jedem Element, sei es des Staates, sei es in der Natur,
wiederzufinden, und die wirklichen Subjekte, wie hier die "politische
Verfassung", werden zu ihrem bloßen Namen, so dass nur der
Schein eines wirklichen Erkennens vorhanden ist.
MEW 1, 211
Der Übergang wird also nicht aus dem besondern Wesen der Familie
etc. und dem besondern Wesen des Staats, sondern aus dem allgemeinen
Verhältnis von Notwendigkeit und Freiheit hergeleitet. Es ist ganz
derselbe Übergang, der in der Logik aus der Sphäre des Wesens
in die Sphäre des Begriffs bewerkstelligt wird. Derselbe Übergang
wird in der Naturphilosophie aus der unorganischen Natur in das Leben
gemacht. Es sind immer dieselben Kategorien, die bald die Seele für
diese, bald für jene Sphäre hergeben. Es kommt nur darauf
an, für die einzelnen konkreten Bestimmungen die entsprechenden
abstrakten aufzufinden.
MEW 1, 208f
![]() Marx
als Theoretiker der Dekadenz und Hoffnungen
Marx
als Theoretiker der Dekadenz und Hoffnungen
Zusammenfassung
Fassen wir zusammen: auch Hegel will die moralischen Gesetze rein aus
der Vernunft ableiten, jedoch – und das ist der gedankliche Fortschritt
– nicht mehr, indem er das Handeln der Einzelnen betrachtet, sondern
indem er von den gesellschaftlichen Verhältnissen als dem Bestimmungsgrund
des Handelns ausgeht; allerdings will er diese wiederum rein aus der
Vernunft begründen.
Damit ist die Unmöglichkeit, auf jeweils bestimmte Gegebenheiten
bezogene Gesetze aus den allgemeinen Bestimmungen der Vernunft, also
aus der Logik, abzuleiten, nicht aufgehoben. Marx' Kritik an Hegels
Rechtsphilosophie zeigt die Fehler auf, mit denen Hegel dieses der Sache
nach unmögliche Vorhaben dennoch auszuführen meinte.
Marx zieht die Konsequenz, dass man bei den wirklichen Gegebenheiten
anfangen und deren Gesetzmäßigkeiten auffinden muss. Die
bürgerliche Gesellschaft erscheint nun nicht mehr als naturgegeben,
sondern als besondere historische Gesellschaftsform.
Allerdings unterscheidet sich diese Gesellschaftsform von allen anderen
dadurch, dass in ihr die Rolle der Individuen nicht an die Person gebunden
ist – wie das im Feudalismus besonders ausgeprägt war –,
sondern nur an deren privates, veräußerbares Eigentum; die
Personen erscheinen daher formal und rechtlich gleich, und diese Gleichstellung
ist es, was im Bewusstsein der in diesen Verhältnissen befangenen
Menschen den Schein erweckt, als wäre der gesellschaftliche Zusammenhang
nichts weiter als ein Zusammenleben vieler Einzelner; seit den Anfängen
des Kapitalismus, also seit der Zeit der Aufklärung bis heute hat
diese Betrachtungsweise die Festigkeit eines allgegenwärtigen Vorurteils.
Demgegenüber zeigt Marx auf, dass die Unterschiede im Eigentum
sehr wohl genügen, um Klassenunterschiede zu begründen, denn
wer nicht genug Eigentum hat, kann an das Lebensnotwendige nur durch
Verkauf seiner Arbeitskraft kommen. Das Klassenverhältnis schließt
ökonomische Gesetzmäßigkeiten ein, die den einzelnen
Akteuren durch die Konkurrenz als Zwänge gegenübertreten.
Deshalb bestimmen nicht die vielen Einzelnen durch ihr Denken die gesellschaftlichen
Verhältnisse, sondern umgekehrt bestimmen die gesellschaftlichen
Verhältnisse deren Handeln und damit auch deren Vorstellungen,
die jene – solange sie nicht begriffen sind – als naturgegeben
erscheinen lassen.
![]() Der
laute Frühling (Film) Gemeinsam aus der Klimakrise
Petitionen
2
Frieden [2]
Der
laute Frühling (Film) Gemeinsam aus der Klimakrise
Petitionen
2
Frieden [2]
![]()
![]() f.f.f. [2]
[3]
f.f.f. [2]
[3]
Leben im Irrenhaus 27. Januar 2024
![]() Mathematik
Aufnahmeprüfung
Uni CAMBRIDGE
Matheaufgaben
DDR Klasse 5 Klasse
10 Matheniveau BRD 2025
Mathematik
Aufnahmeprüfung
Uni CAMBRIDGE
Matheaufgaben
DDR Klasse 5 Klasse
10 Matheniveau BRD 2025